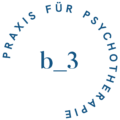Psychotherapie ist ein wissenschaftlich fundiertes und abgesichertes Heilverfahren, welches in zahlreichen Studien seine Wirksamkeit bewiesen hat. Daher wird es auch von Ihrer Krankenkasse bezahlt.
Die Psychotherapie beginnt üblicher Weise mit sog. Sprechstunden und Probesitzungen. Dann kann eine Akut-Behandlung mit zwölf Stunden oder eine Kurzzeittherapie (eins) mit zwölf Stunden und nochmals eine Kurzzeittherapie (zwei) mit weiteren zwölf Stunden oder gleich eine Langzeittherapie von 60 Stunden beantragt werden. Nach den Kurzzeittherapien kann die Umwandlung in eine Langzeittherapie mit 36 weiteren Stunden beantragt werden. Bitte beachten Sie, dass eine Psychotherapie-Stunde 50 Minuten dauert. Die Sitzungen finden in der Regel wöchentlich, in Ausnahmen auch zweiwöchentlich oder gar monatlich statt.
Wenn man Feier- und Urlaubstage mit einbezieht, dauert eine Kurzzeittherapie ca. ein Jahr. Eine Langzeittherapie 1,5 Jahre. Eine „voll ausgereizte“ Therapie von 100 Stunden kann durchaus 5-6 Jahre dauern.
Eine Psychotherapie heilt nicht garantiert. Wer Ihnen das verspricht, ist ein Blender oder Betrüger. Es ist auch nicht vorrangiges Ziel, dass Sie Ihr altes Leben zurückerhalten. Vielmehr ist es das Ziel die Probleme so zu lösen, dass Sie in der Zukunft ein leidensfreies Leben genießen können und am neuen, nicht am alten, Leben mit Freude und Zuversicht teilnehmen können. Ihr Psychotherapeut ist jedoch nicht die Hauptperson, die über den Erfolg der Therapie entscheidet. 80% des Erfolges wird durch die Motivation und andere persönliche Eigenschaften und Voraussetzungen des Patienten gesichert. Der Therapeut ist nur zu 20% für den Erfolg verantwortlich. Trägt der Patient „nur“ 50% zu Erfolg bei bedeutet dies jedoch nicht insgesamt 70% Erfolgschance, sondern die Erfolgschancen sinken rapide mit geringerem Beitrag des Patienten.
Sie können eine Psychotherapie auch machen, wenn Sie Psychopharmaka (Antidepressiva, Neuroleptika) einnehmen. Es gab früher tatsächlich mal die Meinung, dass sich Psychopharmaka und Psychotherapie gegenseitig ausschließen. Man glaubte, dass der notwendige Leidensdruck für die Mitarbeit (Motivation) in einer Psychotherapie dann nicht mehr gegeben ist, oder dass die „Vernebelung“, die Betäubung der Gefühle, eine wirkliche Beziehungsaufnahme zum Therapeuten nicht zulässt. Diese Meinung ist heute jedoch veraltet und schlicht falsch. Psychopharmaka wie Antidepressiva unterstützen sogar die Psychotherapie, da viele Pat. dadurch erst in die Lage versetzt werden, eine Psychotherapie zu machen.
Einen Patienten nicht mit Psychopharmaka zu versorgen um seinen Leidensdruck zu erhalten ist zudem ethisch nicht zu verantworten. Das wäre ähnlich, als würde man einem Patienten mit einem Knochenbruch die Schmerzmittel verweigern.
Die Psychopharmaka haben sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und sind heute bei weniger Nebenwirkungen sehr wirksam und besser verträglich.
Keine Sorge, Antidepressiva machen nicht abhängig, sind als nicht suchterzeugend. Es gibt Nebenwirkungen, die jedoch in der Regel gering und gut beherrschbar sind.
Neuroleptika machen ebenfalls nicht abhängig, jedoch sind die Nebenwirkungen teilweise erheblich. Ihr Arzt, der Ihnen diese Medikamente verordnet hat, wird dies ausführlich mit Ihnen besprechen. Wenn Ihr Arzt Ihnen Neuroleptika empfohlen hat, dann wird dies seine guten Gründe haben und er wird die Nachteile mit den Vorteilen sorgfältig abgewogen haben.
Angstlösende oder beruhigende Medikamente wie Benzodiazepine machen abhängig. Hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. Die Einnahme von Medikamenten dieser Gruppe (Diazepam, Tavor etc.) sollte gut überlegt sein. Von einer längeren Einnahme über 10 Tage oder einer längeren Einnahme nach Bedarf ist abzuraten. Bitte besprechen Sie das ausführlich mit ihrem Arzt. Benzodiazepine stehen in der Liste der Weltgesundheitsorganisation in der gleichen Gruppe wie Alkohol, da es das gleiche Suchtpotenzial und die gleiche Entzugssymptomatik hat und zudem kreuztolerant ist (man kann die Entzugssymptome des einen mit dem anderen „heilen“).
Sollten Sie diese Medikamente über einen längeren Zeitraum (länger als 10 Tage) einnehmen besteht die Gefahr der Abhängigkeit. Dann ist eine Psychotherapie möglicherweise tatsächlich kontraindiziert, d.h. nicht sinnvoll. Vorher müsste ein Entzug stattfinden.
Besprechen Sie dies unbedingt mit dem Arzt der Ihnen diese Medikamente verordnet hat. Stellen Sie ruhig Fragen. Ihr Arzt wird Ihnen ihre Fragen kompetent beantworten und mit Ihnen die Möglichkeit der Reduktion oder des Weglassens der verordneten Medikamente besprechen. Nehmen Sie die Medikamente immer genau so, wie ihr Arzt es verordnet hat. Ich kann nicht diese Entscheidungen treffen, da ich nicht über die Fachkenntnis verfüge und nicht in dem Maße wie Ihr Arzt über ihren Gesamtgesundheitszustand informiert bin.
Generell kontraindiziert ist eine Psychotherapie bei Vorliegen einer stoffgebundenen Sucht (Alkohol, Heroin, Crystal Meth, Benzodiazepine, Amphetamine usw.). Hier muss erst ein Entzug und eine Entwöhnung in einer Klinik erfolgen. Dann kann, bei entsprechender Motivation und „Trockenheit“, eine ambulante Therapie durchgeführt werden. Dies kann auch bei nicht stoffgebundenen Süchten (Spielsucht, Sexsucht) der Fall sein. Dies ist aber im Einzelfall zu überprüfen.
Weiterhin ist eine ambulante Psychotherapie kontraindiziert, wenn die psychischen Symptome durch organische Erkrankungen hervorgerufen wird (Verwirrtheit bei Vergiftungen, Lähmungen durch einen Tumor in der Wirbelsäule usw.). Dann ist eine Psychotherapie nicht indiziert um die Ursachen zu heilen. Sie kann aber indiziert sein um die (sozialen, psychischen) Folgen, die sich aus dieser Krankheit ergeben, zu behandeln.
Eine tiefenpsychologische Richtlinien-Psychotherapie ist kontraindiziert, wenn eine ernsthafte Mitarbeit nicht möglich ist, da er Patient der Therapie geistig (z.B. durch Verwirrtheit, Demenz) nicht folgen kann.
In der Tiefenpsychologie ist eine Therapie nicht möglich, wenn der Patient sich weigert über sich, seine Beziehungen und Gefühle zu sprechen. In der Verhaltenstherapie ist eine Therapie kontraindiziert, wenn der Patient die Mitarbeit bei Hausaufgaben oder Übungen verweigert.
Eine Therapie ist auch dann kontraindiziert, wenn eine akute Suizidgefahr besteht, der Patient den Weg zum Therapeuten nicht schafft oder die Symptomatik bereits so schwerwiegend oder chronifiziert ist, dass diese nur in einer intensiven stationären Therapie (Krankenhaus, Psychiatrie, Psychotherapeutische Klinik) zu behandeln ist.
Nicht zwangsläufig. Ziel der Therapie ist es nicht, bestehende Beziehungen zu trennen. Ziel ist es, Beziehungen zu verbessern. Ist dies jedoch nicht möglich, kann die Therapie auch zu der Einsicht führen, dass es besser ist die Beziehung (Ehe) zu beenden. Dies ist in der Regel jedoch ein schwieriger Prozess und mit vielen belastenden Gefühlen (Schuldgefühlen, Trauer etc.) verbunden. Aber die Möglichkeit, dass es einem nach der Trennung besser geht, ist nach der Trennung von irreparabel gestörten Beziehungen wahrscheinlich.
Nein. Ein Psychotherapeut ist zwar verpflichtet eine Biographische Anamnese durchzuführen. Er muss auch dem Gutachter, der über eine Verlängerung der Therapie entscheidet, über Ihre Biographie berichten (alles natürlich streng anonymisiert, d.h. der Gutachter erfährt ihre Identität nicht). Es ist auch richtig, dass viele psychische Probleme im Erwachsenenalter mit der Kindheit in Verbindung stehen. Trotzdem ist das Hauptaugenmerk der Therapie auf die aktuelle Situation, und auf die aktuellen Probleme gerichtet. Es gilt ganz fokussiert die Probleme zu besprechen und zu lösen, die sie im Hier und Jetzt beschäftigen und bedrängen. Dazu kann es durchaus auch hilfreich sein, hin und wieder Erlebnisse in der Kindheit in Erinnerung zu rufen, um ein besseres Verständnis zu entwickeln. Aber eine Richtlinienpsychotherapie ist nicht dazu geeignet die Kindheit aufzuarbeiten oder gar zu „reparieren“. Allerdings ist dies in einer Psychoanalyse möglich. Hierzu werden aber deutlich mehr Stunden benötigt und auf Antrag auch genehmigt (bis zu 260 Sitzungen). Zudem findet die Psychoanalyse dreimal wöchentlich im Liegen statt.
Die Ausbildung zum Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie kann nur wenige Monate dauern. So bietet die größte deutsche Fernschule (www.ils.de) an: „… 15 Monate, wobei Sie wöchentlich etwa 6-9 Stunden benötigen. Sie können jedoch auch schneller vorgehen…“. Natürlich gibt es auch Heilpraktikerschulen, die eine (meist unwesentlich) längere Ausbildung anbieten. Das ist aber freiwillig und nicht zwingend vorgeschrieben. Da es für die Zulassung als Heilpraktiker nicht zwingend vorgeschrieben ist in einem Krankenhaus (Psychiatrie oder Psychosomatik) ein Praktikum zu absolvieren, haben viele Heilpraktiker (eingeschränkt auf dem Gebiet der Psychotherapie) keinerlei praktische Erfahrung auf diesem Gebiet.
Allerdings müssen Heilpraktiker nicht einmal zwingend eine Ausbildung absolvieren. Jeder der über 21 Jahre alt ist, nicht vorbestraft ist, an keiner schwerwiegenden psychischen oder körperlichen Erkrankung leidet und einen Hauptschulabschluss (egal mit welchem Notendurchschnitt) vorweisen kann, kann sich zu einer Prüfung bei einem Gesundheitsamt anmelden.
Es wurden sogar Bildungsgutscheine zur Ausbildung zum Heilpraktiker durch die ARGE angeboten. So wurden Friseure oder Elektriker, Schlosser, Verkäuferinnen etc. auf Grund von Langzeitarbeitslosigkeit durch eine 100% ARGE-Förderung zu Heilpraktikern auf dem Gebiet der Psychotherapie ausgebildet.
Die lange und umfangreiche Ausbildung bei Ärzten und Psychologischen Psychotherapeuten hingegen ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ein Psychologische Psychotherapeut oder Ärztlicher Psychotherapeut muss in der Regel ein hervorragendes Abiturzeugnis nachweisen um einen Studienplatz zu erhalten. Anschließend muss er im Rahmen seines Studiums mehrere Staatsprüfungen ablegen. U.a. muss ein klinischer Psychologe zwingend in dem Fach Psychopathologie eine Hauptdiplom- oder Masterprüfung ablegen. In der – sich nach dem Studium anschließenden 3-5-jährigen Ausbildung – muss er 600 Stunden Arbeit in der Psychiatrie, 600 Stunden in einer Psychosomatischen Klinik und 600 Einzeltherapie-Behandlungsstunden nachweisen – neben 600 Stunden Theorie in Seminaren.
Heilpraktiker sind nicht approbiert. Bezeichnen sich Heilpraktiker als Psychotherapeuten machen sie sich strafbar. Die Kosten für Psychotherapie werden nicht von Ihrer Krankenkasse übernommen.
Heilpraktiker haben vor Gericht kein Zeugnisverweigerungsrecht.
Auch eine juristische Schweigepflicht, wie es sie bei Ärzten oder Psychologen gibt, die gesetzlich geregelt und strafbewehrt ist, gibt es bei Heilpraktikern nicht.
Wenn Heilpraktiker „alles weitererzählen“, hat das für sie zumindest keine strafrechtliche Konsequenz:
Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht
Heilpraktiker unterliegen, im Gegensatz zu Ärzten, Psychotherapeuten, Berufspsychologen oder anderen Heilberufen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, nicht der strafrechtlichen Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB). Das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO, wie es unter anderem für Ärzte, psychologische Psychotherapeuten und Geistliche in ihrer Eigenschaft als Seelsorger gilt, erstreckt sich somit nicht auf Heilpraktiker. Zivilrechtlich ist der Heilpraktiker normalerweise durch den mündlichen oder schriftlichen Behandlungsvertrag zur Verschwiegenheit verpflichtet, welche nur für Mitglieder eines Berufsverbandes nach Artikel 3 der Berufsordnung für Heilpraktiker vorgeschrieben ist. [11]
http://de.wikipedia.org/wiki/Verschwiegenheitspflicht
Diese „Verschwiegenheitspflicht“ haben sich einige Heilpraktikerverbände selbst gegeben: Da jedoch die BOH nicht einheitlich für alle Heilpraktiker gilt, besitzt sie auch keine rechtliche Bindungswirkung.
…paracelsus.de/recht/hp_boh.html
An diese unverbindliche Berufsordnung, die bei Verstößen ohne rechtliche Konsequenz bleibt, kann er sich halten, muß es aber nicht.“
Lassen Sie sich nicht durch einen Doktortitel täuschen. Oft sind diese Doktoren keine promovierten Psychologen oder Ärzte. Beispielsweise ist der Dr. paed. kein Arzt sondern ein promovierter Pädagoge (Also Lehrer oder Erzieher). Pädagogik und klinische Psychologie / Medizin unterscheiden sich gravierend und dürfen nicht verwechselt werden. Psychopathologie und Psychotherapie sind keine Fachgebiete der Pädagogik. Ich habe sogar Heilpraktiker kennen gelernt, die mit einem Dr. in Betriebswirtschaft „geglänzt“ haben.
Von Heilpraktikern werden neben den psychologischen Beratungen und Gesprächen oft auch dubiose Heilverfahren wie Reiki oder Kinesiologie angeboten – um nur zwei von vielen zweifelhaften Verfahren zu nennen. Diese Verfahren entbehren jeglicher Seriosität. Es gibt keine wissenschaftlich Nachweise, dass diese Verfahren in irgendeiner Weise Krankheiten heilen oder diagnostizieren können. Es gibt jedoch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, dass diese Anwendungen als unwirksam und somit als Pseudowissenschaften bezeichnet werden können.
siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Kinesiologie
Daher gibt es große fachlich-qualitative Unterschiede zwischen Heilpraktikern und Ärzten / Psychologischen Psychotherapeuten.
Zwischen ärztlichen Psychotherapeuten und psychologischen Psychotherapeuten bestehen keine wesentlichen Unterschiede in der Behandlung. Beide haben eine vergleichbare psychotherapeutische Ausbildung und verfügen über die entsprechenden Fähigkeiten eine qualitativ hochwertige Behandlung durchzuführen.
Psychiater dürfen in der Regel auch Richtlinienpsychotherapien durchführen, machen dies jedoch häufig (aus Zeitgründen) nicht oder nur in eingeschränktem Maße. Psychiater sind für die „schwerwiegenderen“ psychischen Erkrankungen, wie Psychosen oder Demenz zuständig. Psychiater dürfen Medikamente wie Antidepressiva, Neuroleptika, Beruhigungsmittel u.a. verschreiben und kennen sich darin sehr gut aus, da sie regelmäßig über Nebenwirkungen, ungünstige Interaktionen mit anderen Medikamenten und spezifischen Wirkungsweisen durch Weiterbildungen und Referenten der Pharmaindustrie informiert werden. Psychologen, also auch ich, dürfen keine Medikamente verschreiben.
Verhaltenstherapie beschäftigt sich, stark vereinfacht ausgedrückt, mit dem Verhalten. Tiefenpsychologie hingegen beschäftigt sich mit den tieferen seelischen Prozessen, ebenso wie die Psychoanalyse, die jedoch länger dauert, zeitaufwendiger ist und noch intensiver die Kindheit in die Therapie mit einbezieht (aufarbeitet).
Verhalten wird in der Realität gezeigt und kann beobachtet werden. Verhaltenstherapeuten versuchen für den Patienten ungünstige Verhaltensweisen zu erkennen und so zu verändern, dass diese den Patienten in seinem alltäglichen Leben nicht mehr negativ beeinflussen, z.B. in der Interaktion mit anderen oder mit sich selbst. Dazu werden auch Hausaufgaben in Form von Tagebüchern oder Selbstbeobachtungslisten gegeben. Ziel hierbei ist es, die Bedingungen für das störende Verhalten herauszufinden und dann durch weitere (Haus-) Aufgaben oder Übungen, die selbstständig oder mit dem Therapeuten, in der Praxis oder außerhalb der Praxis, durchgeführt werden, zu verändern.
Tiefenpsychologen und Psychoanalytiker beschäftigen sich mit innerseelischen Vorgängen, den Konflikten welche mit Wünschen und Bedürfnissen, Ängste etc. in Beziehung stehen. Diese können bewusst oder unbewusst sein. Die unbewussten innerpsychischen Konflikte und die damit verbundenen Abwehrvorgänge (Verdrängungen) sind es, die krank machen (auch Neurosen genannt). Es gilt diese unbewussten Konflikte soweit bewusst werden zu lassen, dass diese bearbeitbar und durch die Bearbeitung auflösbar werden. Dann müssen diese Konflikte nicht mehr so stark verdrängt werden, und die durch die Verdrängung gebundene Energie steht wieder den positiven Lebensaspekte (Liebe, Beziehung, Leistungsfähigkeit) zur Verfügung. Um dies zu ermöglichen ist es wichtig, dass der Patient frei assoziiert, d.h. alles was ihn gerade beschäftigt oder ängstigt, in der Therapiesitzung ungefiltert und unzensiert ausspricht. Dazu ist es wiederum wichtig, dass eine vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten besteht. Dieses Vertrauensverhältnis entsteht meist erst durch viele Therapiesitzungen, d.h. es ist etwas Geduld erforderlich, bis dieses Vertrauensverhältnis entstanden ist.
Oft versuchen diese unterschiedlichen Therapieverfahren, ihre besonderer Wirksamkeit gegenüber den anderen Verfahren durch Studien zu belegen. Dies ist jedoch oft verwirrend und falsch. Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologische Verfahren sind gleichermaßen wirksam und erfolgreich – nur eben auf unterschiedlichen Wegen.
Nein, in der Therapie muss es einem nicht schlechter gehen. Aber es ist durchaus möglich. Bitte lesen Sie dazu die Seite Risiken und Nebenwirkungen durch.
Einen guten Therapeuten erkennen Sie zunächst an der qualifizierten Ausbildung (Universitätsstudium, Approbation und Facharztausbildung). Üblicherweise achten die Krankenkassen darauf, dass der Therapeut und damit seine Behandlung den Qualitätsmaßstäben entspricht. Wenn eine Kasse also die Kosten übernimmt, ist dies ein erstes Anzeichen für einen kompetenten Therapeuten. Zudem können Sie sich auch über die Qualifikationen des Therapeuten über seine Webseite informieren, oder indem sie ihn direkt fragen.
Ein seriöser Psychotherapeut wird Ihnen niemals eine Heilung garantieren und schon gar nicht auf schnellem Weg. Wenn Ihnen jemand eine Heilung innerhalb kürzester Zeit (manchmal sogar in nur eine Sitzung) verspricht – und zudem durch suspekte Handlungen wie Kartenlegen, Handauflegen, schamanistische Rituale oder solchen Dingen wie „Energieströme kanalisieren“ (Reiki), ist er ein Scharlatan und Betrüger und will im Grunde nur an Ihr Geld.
Eine „Heilung“ kann sehr unterschiedlich sein und muss auf die jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Patienten abgestimmt sein. Ein Therapieerfolg kann auch sein, wenn sich die Beschwerden nur langsamer verstärken oder der jetzige Zustand beibehalten wird. Im Idealfall tritt eine Besserung ein, die gering – und trotzdem ausreichend – oder – im Idealfall – ganz deutlich ausfällt. Jeder Patient ist anders und so ist auch die Dauer, die Ziele und der Erfolg der Behandlung individuell unterschiedlich. Manch mal brauchen kleine Veränderungen viel Zeit. Und manch mal kann Großes in kurzer Zeit erreicht werden.
Gute Therapeuten bieten nur wissenschaftlich fundierte und anerkannte Verfahren an. Schlechte Therapeuten weichen (oft aus Hilflosigkeit oder Unvermögen) auf unwissenschaftliche Verfahren aus, die entweder esoterisch oder gerade in Mode sind.
Die in der Ausbildung gelernten Techniken und Verfahren sind für eine erfolgreiche Therapie vollkommen ausreichend.
Die Kosten für eine Richtlinienpsychotherapie bei vorliegender Indikation wird von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse vollständig übernommen. Privatpatienten sehen bitte in ihren Vertrag oder fragen bei der Privatkasse nach.
Kosten entstehen nur, wenn Sie Stunden versäumt haben, ohne sich rechtzeitig abzumelden. Diese Bedingungen sind in den Therapieverträgen geregelt (siehe Gruppentherapievertrag, Einzeltherapievertrag)
Die Belastungen in der Arbeitswelt, aber auch in privaten Beziehungen sind deutlich gestiegen. Diejenigen, die Arbeit haben, müssen oft deutlich mehr und intensiver arbeiten als noch vor 50 oder 100 Jahren. Die existenziellen Ängste bei einem Arbeitsplatzverlust sind deutlich größer geworden, da wir auch für mehr Wirtschaftsgüter (Kredite für Auto, Haus, Möbel usw.) verantwortlich sind und mehr Verpflichtungen (Finanzierung des Studiums der Kinder, Unterhaltszahlungen etc.) eingehen als früher. Aber auch diejenigen, die keine Arbeit haben leiden unter der gesellschaftlichen Stigmatisierung und durch die gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist oft nur durch Geld möglich (Kino, Theater, Essen gehen, Vereine, Fitnessstudio, Urlaub, etc.).
Das Rollenbild von Männern und Frauen hat sich stark verändert. Männer sollen auch weibliche Fähigkeiten besitzen, Frauen sollen die Männer- und Väterrollen übernehmen. Der Partner, die Partnerin soll der beste Freund, Liebhaber, Vater, Versorger sein, er soll erfolgreich, schön und jederzeit verständnisvoll sein. Die Erwartungen sind teilweise riesengroß, belasten und überfordern viele Beziehungen.
Auch früher gab es zahlreiche Menschen mit psychischen Störungen (Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Schmerzstörungen), welche dringend einer Behandlung bedurft hätten (z.B. viele durch den Krieg traumatisierte Menschen). Damals gab es jedoch nicht die entwickelten Therapiemöglichkeiten und es gab keine ausgebildeten Therapeuten in modernen Therapieverfahren und nicht in ausreichender Zahl. Zudem waren die Therapien für viele zu teuer und – vielleicht der wichtigste Punkt: viele haben sich geschämt und der Gang zum Psychotherapeuten oder Psychiater war stark tabuisiert.
Wie auch bei anderen körperlichen Krankheiten und Störungen, die vor vielleicht 100 Jahren nicht entdeckt und behandelt wurden, werden heute viele psychische Störungen besser erkannt und verstanden und sind somit auch besser behandelbar. Dadurch steigt auch die statistische Zahl der gemeldeten psychischen Störungen und Diagnosen und der Behandlungen.
Von der Behandlung psychischer Störungen auf Kosten der Allgemeinheit, durch die gesetzlichen Krankenkassen, profitieren wir alle. Denn gesunde Menschen sind arbeitsfähig, beziehungsfähig und können somit auch ihren wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Psychotherapie leistet also einen bedeutenden Anteil am (auch wirtschaftlichen) Erfolg unserer Gesellschaft.
Eine kassenfinanzierte Richtlinienpsychotherapie können sie nur bei vorliegender Indikation in Anspruch nehmen. Diesen Anspruch prüft der Psychotherapeut. Wenn der Psychotherapeut also einer Therapie zustimmt und Sie aufnimmt, dann bestehen auch die medizinische Notwendigkeit und Berechtigung, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Da psychisches Erleben individuell sehr unterschiedlich ist, kann man nicht pauschal entscheiden wem es wirklich so schlecht geht, dass er Anspruch auf eine Psychotherapie erheben kann. Manch einer kann auch mit einer psychischen Störung ohne Psychotherapie (vielleicht mit medikamentöser Behandlung) ausreichend gut leben. Oder andere sind sogar so stark belastbar, dass ihnen auch schlimmste Ereignisse nichts anhaben können. Entscheidend ist nicht nur wie stark das auslösende Ereignis, die seelischen und körperlichen Schmerzen oder die psychische Spannung ist. Entscheidend ist, wie groß der Leidensdruck, wie stark die Einschränkungen im Leben, in den Beziehungen und der Bewältigung der Alltagsaufgaben ist.
Der Arzt oder Psychotherapeut unterliegt der Schweigepflicht. Dies ist in einem Gesetz geregelt. Er riskiert sogar eine Gefängnisstrafe, wenn er anderen, sogar anderen Ärzten, ohne Ihre Einwilligung Informationen über die Behandlung weitergibt. Auch der Partner, die Partnerin, die Eltern, Kinder oder andere Angehörige dürfen nicht über Therapieinhalte informiert werden. Schon alleine die Information, dass Sie bei einem Therapeuten in Behandlung sind, ist durch die Schweigepflicht untersagt. Dies gilt sogar über den Tod des Patienten hinaus. Ihrer Krankenkasse wird nur die Diagnose mitgeteilt, damit diese die Möglichkeit hat, zu prüfen, ob die Therapie eine reguläre Kassenleistung ist.
Link zum Thema Schweigepflicht
Auch die Polizei und Gerichte haben keine Befugnis über die Therapieinhalte informiert zu werden.
Wenn allerdings ein Patient eine schwere Straftat wie z.B. einen Mord glaubhaft ankündigt, bin ich verpflichtet dies zur Gefahrenabwehr und zum Schutz anderer zu melden. Auch bei dem glaubhaften Hinweis sich das Leben zu nehmen, wäre ich verpflichtet, zum Schutze des Patienten, dies zu melden und sichernde Maßnahmen einzuleiten (z.B. Unterbringung in einem Krankenhaus).
Zum Schutze meiner Patienten, werden von mir auch keine Angehörigen (Partner, Eltern, Kinder etc.) behandelt, da dies zu Loyalitätskonflikten meinerseits führen könnte.
Eine Psychotherapie muss immer freiwillig sein. Wenn Sie mit mir als Therapeuten unzufrieden sind, können Sie die Therapie abbrechen und die Therapie mit den verbleibenden Stunden bei einer anderen Therapeutin, bei einem anderen Therapeuten fortsetzen. Sie sollten jedoch den Abbruch der Therapie in einer letzten Stunde mit mir besprechen. Dabei geht es nicht darum, dass Sie sich dafür rechtfertigen müssen oder ich noch die Gelegenheit haben soll, Sie zu einer Fortführung zu überreden. Vielmehr geht es darum die Gründe zu reflektieren und etwaige Missverständnisse abzuklären. Sie haben durch einen vorzeitigen Therapieabbruch keinerlei formalen Nachteile.
Ja, Sie können die Probesitzungen, die antragsfrei von der Kasse bezahlt werden auch bei verschiedenen Therapeuten in Anspruch nehmen. Sie sollen ja den Therapeuten finden, bei dem Sie sich wohl fühlen und bei dem Sie den größten Erfolg erzielen. Allerdings handhabe ich es so, dass während der Probestunden bei mir keine Probestunden bei einem Kollegen genommen werden sollen. Dies verhindert ein sog. „Übertragungssplitting“. D.h. sie werden durch die unterschiedlichen Beziehungseindrücke nicht verwirrt.
Zudem ist es meiner Ansicht nach, ein wichtiges und gesundes Beziehungsmerkmal, dass man Beziehungen nicht konsumiert, sondern sich erst einmal wertschätzend auf ein Beziehungsangebot einlässt. Sollten Sie feststellen, dass ich nicht der richtige Therapeut für Sie bin, können Sie problemlos zu einer Kollegin oder Kollegen wechseln.
Die Erfahrung zeigt, dass „geschickte“ Patienten meist nicht ausreichend für eine Psychotherapie motiviert sind. Häufig möchte der Partner (der ja ebenfalls unter der Störung leidet), dass derjenige eine Therapie macht. Die, manchmal mühsame, Suche nach einem Therapeuten ist der erste Teil einer ambulanten Psychotherapie, der unbedingt geleistet werden sollte.